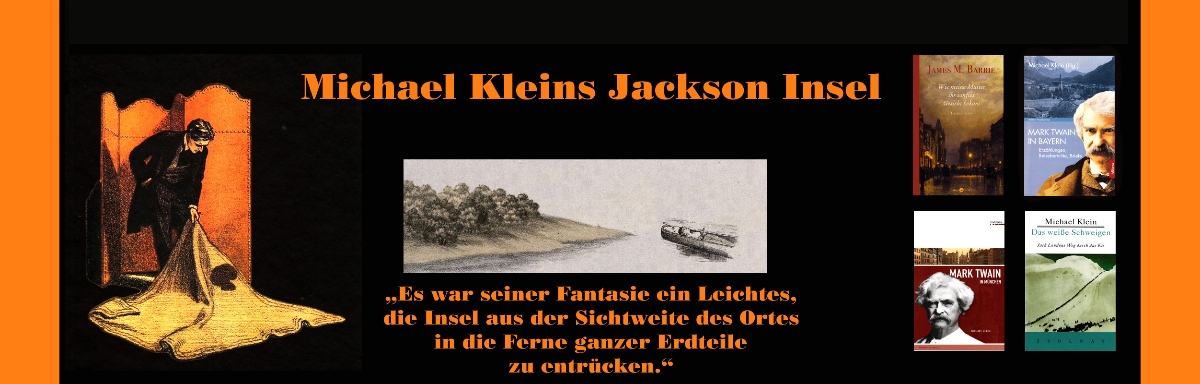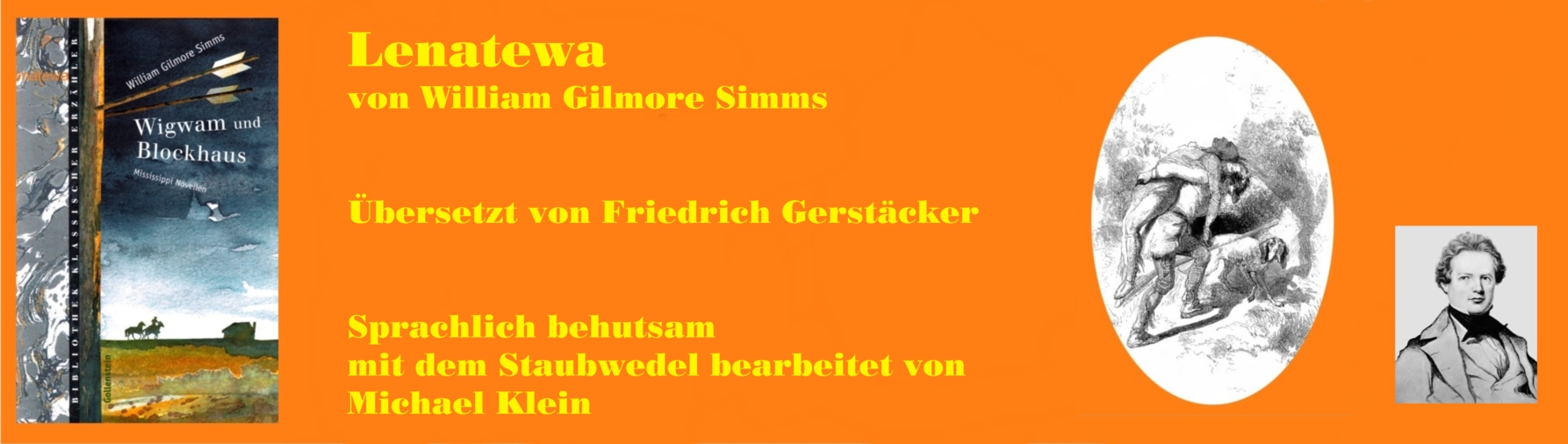
2. Kapitel
Nun meine Freunde – sagte der siebzigjährige Veteran, seine Gestalt aufrichtend und den rechten Arm von sich streckend, während die linke Hand die Mündung seiner mit dem Kolben auf den Boden gestützten Flinte erfasste –, da die Nacht so hell und still war und ich kein Bedürfnis nach Schlaf fühlte, rief ich meinen Clinch und machte mich auf den Weg zu Jacob Ransom. Ich wusste, dass er ein schläfriger Bursche sei, und wenn die Rothäute jemanden unvermutet hätten überfallen können, wäre er es zuerst gewesen.
Ich gestehe indes, dass ich diesen Gang nicht nur seinetwegen, sondern unser aller, ja meiner selbst wegen tat, denn ich konnte mir die Gefahr nicht verhehlen, in der wir schwebten, wenn wir nicht vereint jedem Überfall Trotz böten. Schon der Gedanke, meiner Betsy langes, goldnes Haar um die Hand irgendeines farbigen Teufels geschlungen, die Kinder in seiner Armen zu erblicken, ohne dass ich als einzelner Mann ihnen hätte Hilfe bringen können – schon der bloße Gedanke war eine Hölle, und das Haar sträubte sich mir, wenn ich daran dachte. Ich stand still und betete, zu den Sternen aufblickend, während ich fühlte, dass wir alle in Gottes gnädiger Obhut lebten. Dies beruhigte mich einigermaßen wieder, und ich schritt mit frischem Mut weiter. Obwohl mir übrigens der Pfad bei Nacht so bekannt wie bei Tage war, ging ich doch nicht sehr schnell, weil ich beständig nach Feinden umherspähte.
Als wir nun bis an einen Graben gelangt waren, an dem sich der Weg teilte, indem der eine über die Hügel, der andere durch die Niederungen führte, wählte ich, ohne weiter darüber nachzudenken, den über die Hügel, obwohl er der längere war.
Wir gingen weiter, ich voran, Clinch dicht hinter mir. Er war ein ausgezeichnet guter Hund, von scharfer Witterung, doch schien jetzt nichts seine Aufmerksamkeit zu wecken. Der Hügel, den wir erstiegen, dehnte sich ziemlich steil empor, und als ich den armen Clinch ansah, der ermüdet schien, fiel mir ein, dass wir schon seit Tagesanbruch im Wald herumstreiften und dass das arme Tier müde und hungrig sein müsse; wir hatten indes schon den halben Weg zurückgelegt, und ich war nicht geneigt umzukehren, bis ich Jacob meine Meinung mitgeteilt hatte.
Als ich den Gipfel des Hügels erreichte, stand ich still und rieb mir die Augen, hatte auch alle Ursache dazu, denn ich erblickte in einiger Entfernung vor mir ein großes Feuer. Zuerst fürchtete ich, es wäre Jacobs Haus, doch besann ich mich bald, dass dieses weiter links gelegen und das Feuer offenbar rechts, mehr nach der Gegend meiner eigenen Wohnung hin sein musste.
Mein Erschrecken war groß, und ich durfte jetzt nicht daran denken, Jacobs Haus aufzusuchen, sondern wandte mich um und lief, von Clinch zögerlich gefolgt, dem Feuer zu. Die Bäume standen lediglich vereinzelt und auch Büsche gab es wenige, so dass wir durch nichts aufgehalten wurden. Mit welcher Angst und Schnelligkeit ich aber auch eilte, schien mir doch, als komme ich nicht von der Stelle – das Feuer brannte immer hell in gleicher Entfernung vor mir.
Ich stand still und sah meinen Hund an; er sah zu mir herauf, doch keiner von uns hatte etwas zu sagen. Schließlich schien mir doch, da ich so weit gelangt war, könne ich die Sache nicht aufgeben, und eilte aufs neue vorwärts. Wir erstiegen mehere kleine Hügel, hinauf und hinab und wieder hinauf, bis wir einen erreichten, den die Indianer Nolleehatchie nennen. Jetzt schien ich dem Feuer nähergerückt zu sein. Es brannte etwa zweihundert Schritt von mir entfernt auf einer kleinen Erhöhung und war ein ziemlich großes Feldfeuer, von mehr als einem Dutzend Indianer umgeben.
Gut, sagte ich mir, die haben uns ja tüchtig überrumpelt. Doch was ist zu tun? Keine Menschenseele in der Ansiedlung weiß Bescheid, und niemand wacht als ich. Wie leicht können die anderen in ihren Betten skalpiert oder von der Feuersbrunst geweckt und beim Versuch, dem Brand zu entkommen, von den Pfeilen der Indianer tödlich getroffen werden!
Kalter Schweiß überlief mich, als ich dies dachte, ich wusste nicht, was beginnen. Ich sah mich nach meinem Hund um und bemerkte zu meinem Erstaunen, dass er sich ruhig hingesetzt hatte, mich und die Sterne anschaute und das Feuer gerade vor uns gar nicht zu beachten schien. Und doch war Clinch ein ausgezeichneter Jagdhund, der die Spur eines Indianers auch aus weiter Entfernung witterte. Er verstand ich mich und wusste, ob er bellen dürfe oder nicht, auch war jetzt der Augenblick, wo er sich hätte still verhalten müssen – aber er schien das Feuer nicht einmal zu bemerken. Mir kam das von einem so klugen Hund ordentlich unnatürlich vor, dass er ganz ohne Aufmerksamkeit, mit schläfrigen, halb geschlossenen Augen dasaß und sich sogar, während ich ihn einigermaßen erzürnt betrachtete, niederstreckte, seine Nase auf die Füße legte und zu schlafen anfing.
Ich wurde derart zornig darüber, dass ich ihn beinahe mit meinem Messer ermordet hätte, doch besann ich mich eines besseren. Ein Hund kann am Ende ebensowenig dem Naturtrieb, der ihn zu schlafen zwingt, widerstehen wie ein Mensch, und dann wusste er ja auch nicht, dass die Indianer nicht mehr freundschaftlich gegen uns gesinnt waren.
So stand ich eine gute Weile da, schaute und wusste nicht, was ich tun sollte – bis ich mich endlich schämte, derart unentschlossen zu sein, und die Notwendigkeit bedachte, jetzt oder später vom Schlimmsten unterrichtet zu werden. Ich entschloss mich daher, so weit wie möglich vorzudringen.
Ich war kein ungeschickter Jäger, wie ihr euch denken könnt, und begann, als ich mich dem Feuer näherte, auf Händen und Füßen zu kriechen, legte mich, wo weder Baum, noch Busch mich verdeckte, platt auf den Boden und bewegte mich auf diese Weise vorwärts, von meinem Hund dicht gefolgt, der übrigens keine besondere Aufmerksamkeit zeigte.
Als ich auf diese Weise langsam näherrückte, schien das Feuer immer größer zu werden, und ich sah die Indianer zahlreich darum gelagert, doch hinderte mich der Rauch, der sie einhüllte, dass ich ihre Gestalten deutlich unterscheiden konnte.
Jetzt war ich an einem Punkt angelangt, von dem aus ich alles genau zu übersehen meinte. Ich hatte mich hinter einem Felsvorsprung verborgen, von dem sie kaum zwanzig Meter entfernt und durch Buschwerk getrennt waren. Es vergingen indes mehrere Minuten, bis es mir möglich war, durch den wirbelnden Rauch ihre Bewegungen zu erkennen, und als ich sie endlich deutlich sah, erschütterte mich der Anblick in tiefster Seele. In der Mitte dieser Rothäute stand ein weißes Wesen, und diese Wesen schien eine Frau zu sein.
Ich täuschte mich nicht. Da saßen die Indianer, einige mit dem Rücken gegen mich gewandt, andere mit dem Gesicht mir zugekehrt, und dort ein wenig seitwärts, aber in ihrer Mitte, saß eine Frau. Wenn der Rauch für Momente fortgeweht wurde, sah ich ihr weißes Antlitz wie einen hellen Stern durch dunkle Wolken schimmern; sie erschien mir aber so totenbleich, dass mich der Gedanke erfasste, der Schreck hätte sie getötet. Ich überzeugte mich freilich bald, dass dies nicht der Fall war, denn sie saß lediglich ruhig da und blickte ihre Umgebung an. Die Indianer waren regungslos, sie lehnten oder lagen in derselben Stellung, in der ich sie zuerst gesehen hatte, bewegten sich nicht, sprachen nicht, waren starr wie der Stein, über den ich mich lehnte. Ich vermochte kein Gesicht unter ihnen zu erkennen, obwohl ich ihre Gestalten, eingehüllt in Büffelhäute und Tücher, genau unterscheiden konnte. Ihre Züge blieben durch Rauch und Dunkelheit verborgen. Die Frau sah ich aber deutlich. Sie schien sehr jung, etwa fünfzehn Jahre zu sein, und es war mir, als müsse ich sie kennen. Sie war schön, ihr Haar hing aufgelöst über ihre Schultern. Mein Herz schlug heftiger, je länger ich sie ansah. Ich hätte für sie sterben mögen und fühlte doch nicht Kraft genug, meine Flinte von der Schulter zu nehmen.
Das Wundersamste bei der ganzen Sache war die vollständige Regungslosigkeit der Indianer. Kein Wort wurde gesprochen, nichts rührte sich – es war, als wären sie bloße Bilder, die das Mädchen anstarrten und ihrerseits von dem Mädchen angestarrt wurden.
Nie zuvor im Leben fühlte ich mich derart von Furcht und Schwäche gelähmt. Was sollte ich tun?
Ich war so nahe herangekommen, dass ich mit einem Wurf jedem der Versammlung hätte mein Messer ins Herz schleudern können, hatte aber nicht den Mut, es zu tun. Ohne mich zu besinnen, wo ich mich eigentlich befand, fing ich an, wie ein Kind zu weinen. Aber auch mein Weinen veranlasste sie nicht, sich umzublicken, nur mein guter Hund sprang sogleich winselnd an mir herauf, als wolle er mich trösten. Ich versuchte nun, ihn auf die Lagernden zu hetzen, er schien mich aber nicht zu verstehen. Meine Verzweiflung stieg zu einer Art Wahnsinn, und ich sprang vorwärts mitten in die Versammlung hinein, fest entschlossen, lieber zu sterben, als noch länger in diesem qualvollen Zustand des Entsetzens zu verharren.
Fortsetzung folgt: Kapitel 3 demnächst an dieser Stelle.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und auf diesem Weg geht es zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.