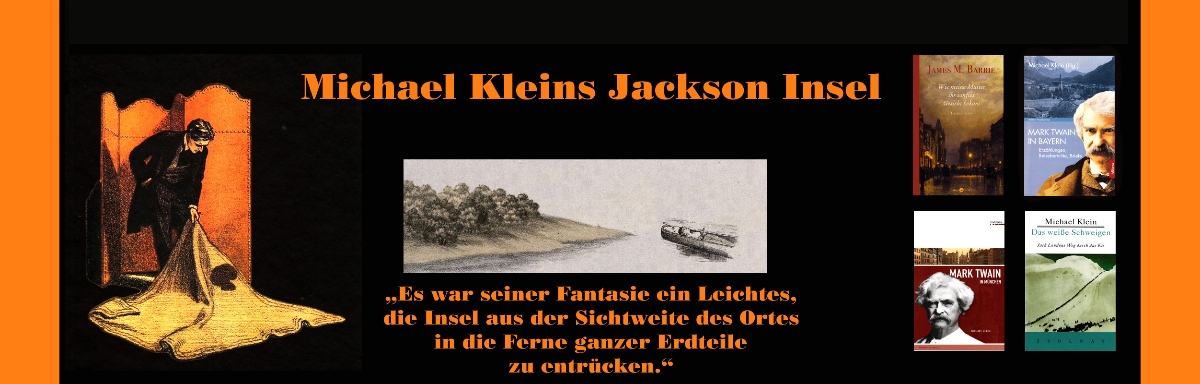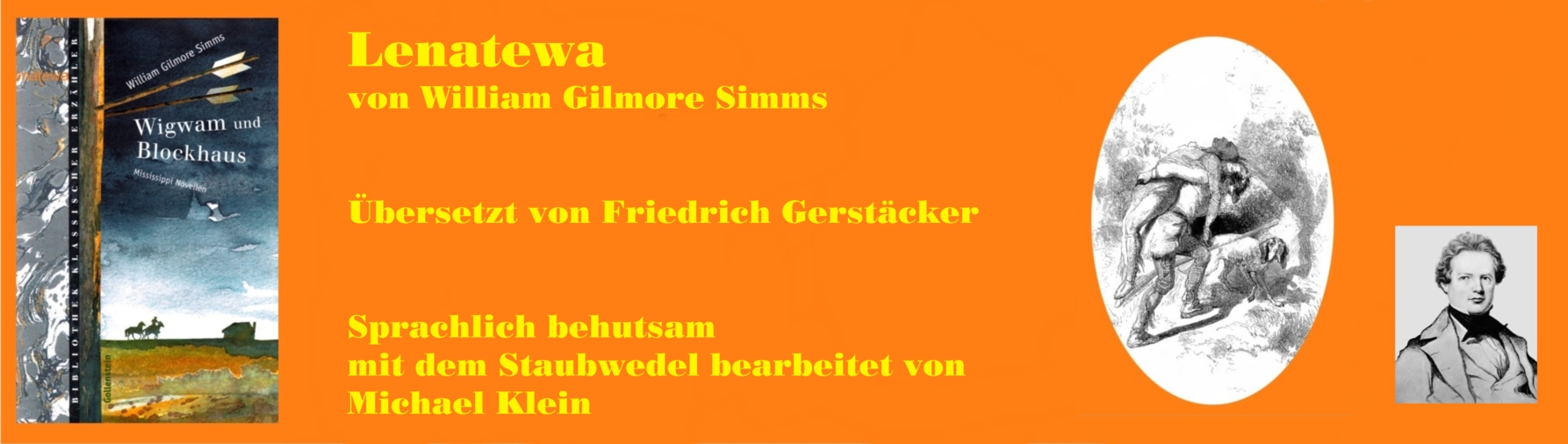
3. Kapitel
Werdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass hier keine Indianer, kein Feuer, keine junge Frau zu sehen waren?
Ich stand auf dem Platz, auf dem ich noch vor einem Augenblick die Flammen gesehen hatte – er war leer! Keine Spur eines Feuers, wohin ich auch blickte. Unter meinen Füßen raschelten dürre Blätter wie überall im Wald. Ich war wie betäubt, gleich einem, der durch einen sonderbaren Traum aus dem Schlaf geweckt wird. Alles um mich her war still und dunkel. Die Sterne, die über mir funkelten, verbreiteten das einzige Licht, aber ich fühlte mich noch entsetzter als vorher und empfand tief die Wahrheit, dass – wo menschliche Kraft uns verlässt – wir nur bei Gott Stärke finden können. Ich kniete nieder und betete – zum zweiten Mal in dieser Nacht, und vielleicht zum zweiten Mal im Wald überhaupt.
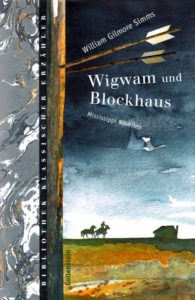 Danach fühlte ich mich beruhigter und nahm die Überzeugung mit mir, dass ich diese Erscheinung nicht ohne Grund gehabt hatte. Als ich mich auf den Heimweg begab, wurde Clinch munter und spitzte die Ohren. Ich klopfte ihm den Rücken und hielt mein Messer in Bereitschaft; vielleicht galt seine Aufmerksamkeit einem Panther, dessen Spur er in großer Entfernung witterte. Da er aber keine Furcht, sondern nur eine größere Lebhaftigkeit zeigte, wusste ich, dass nichts Gefährliches in der Nähe sein könne.
Danach fühlte ich mich beruhigter und nahm die Überzeugung mit mir, dass ich diese Erscheinung nicht ohne Grund gehabt hatte. Als ich mich auf den Heimweg begab, wurde Clinch munter und spitzte die Ohren. Ich klopfte ihm den Rücken und hielt mein Messer in Bereitschaft; vielleicht galt seine Aufmerksamkeit einem Panther, dessen Spur er in großer Entfernung witterte. Da er aber keine Furcht, sondern nur eine größere Lebhaftigkeit zeigte, wusste ich, dass nichts Gefährliches in der Nähe sein könne.
Einen Augenblick darauf sprang er schnell voraus, ich folgte ihm und vernahm, nachdem ich etwa zwanzig Schritt den Hügel hinab in eine Senke geeilt war, ein leises Stöhnen. Ich verdoppelte meine Schritte und gelangte am Ende dieser Niederung an eine Art Teich. Clinch lief darauf zu, und ein zweites Stöhnen ließ mich dieselbe Richtung nehmen. Als ich den Hund erreichte, stand er am Fuß eines alten, halb im Wasser versunkenen, umgestürzten Baums, ich sprang darauf und erblickte, nachdem ich einige Schritte vorwärts tat, ein menschliches Wesen, auf dem Stamm liegend, das Haupt nieder- und die Beine im Wasser hängend. Ich rief Clinch zurück und näherte mich dem Geschöpf, dessen Stöhnen wieder anhob.
Als ich seinen Kopf, sein Haar berührte, wusste ich, dass es ein Indianer war. Meine Finger klebten am Blut, mit dem er bedeckt war, und als ich versuchte, sein Haupt zu wenden, um sein Gesicht zu sehen, stöhnte er heftiger. Hier war keine Zeit zu verlieren, ich bückte mich zu ihm hinab, stemmte meine Füße fest auf den alten Baum, der glatt und schlüpfrig war, und brachte den armen Burschen ohne große Mühe von seinem Platz. Er war nicht schwer, ein Junge von etwa vierzehn bis fünfzehn Jahren – umso unbegreiflicher kam es mir aber vor, ihn in diesem Zustand zu finden. Ich legte ihn aufs trockene Laub nieder, worauf sein Stöhnen verstummte.
Anfangs glaubte ich, er sei jetzt tot, ich fühlte nach seinem Herzen, das aber noch matt zu schlagen schien. Die nächste Frage war: Was nun weiter beginnen? Es war spät in der Nacht, und da ich den ganzen Tag auf den Füßen gewesen war, hielt ich es kaum noch für möglich, selbst beim besten Willen, fähig zu sein, eine solche Last zu meiner Wohnstatt zu tragen. Ihn aber hier lassen hieß, ihn dem sicheren Tod preiszugeben. Wenn ich einen Sohn in vergleichbarer Lage hätte, dachte ich, was würde ich wohl von dem denken, der erst heimgehen und das Tageslicht zu seiner Hilfe abwarten wollte!
Nein, rief ich aus, möge es gehen, wie es wolle, ich verlasse den Jungen nicht! Ich schnürte meinen Gurt fester, nahm meine ganze Kraft zusammen und hob ihn auf meine Schultern.
Meine Hütte war etwa drei Meilen entfernt, und ihr könnt glauben, dass ich keine geringe Mühe hatte, sie mit meiner Last zu erreichen, und nicht wenig ermüdet war, als ich den armen Burschen bei meinem Feuer niederlegte. Ich rief nach Betsy, und wir bemühten uns nun beide, ihn wieder zum Leben zu bringen. Sie schnitt ihm das Haar ab und wusch ihm das Blut vom Kopf, der bis auf den Schädelknochen entweder mit einem Messer oder einem Beil gespalten war. Es schien ein Wunder, dass es nicht bis ins Hirn gedrungen war, denn gezielt war gut genug.
Als wir seine Kleider öffneten, fanden wir eine zweite tiefe Wunde in der Seite, die von einem Messer herrührte. Seine ganze Kleidung war mit Blut getränkt. Da wir aber nicht viel von Heilkunde verstanden, wuschen wir seine Wunden nur mit etwas Rum und Wasser aus und flößten ihm von ersterem ein wenig ein, worauf er anfing, lauter zu stöhnen, ein Beweis, dass mehr Leben in ihn zurückkehrte. Wir rieben seinen Körper mit warmen Tüchern und gaben ihm, als er sich leise zu regen begann, reichlich Wasser zu trinken. Dies schien ihm gut zu tun; wir hüllten ihn dann warm ein, und ich streckte mich an seiner Seite neben dem Feuer hin.
Es würde mich zu lange aufhalten, wenn ich euch erzählen wollte, wie er sich langsam nach und nach erholte. Genug, wir stellten ihn in kurzer Zeit wieder völlig her, ohne gerade mehr für ihn zu tun, als wir im Anfang getan hatten. Er war ein guter Bursche, obgleich zu Anfang sehr scheu, so dass er kaum wagte, uns anzublicken. Ich glaube, wäre er fähig gewesen, die Hütte zu verlassen, würde er es im ersten Augenblick getan haben, an dem er sich wieder bewegen konnte.
Er war aber zu schwach, einen solchen Versuch zu machen, und wurde auch bald durch unsere Freundlichkeit beruhigt. Nach und nach begann er, mit der kleinen Lucy zu spielen, die damals kaum sechs Jahre alt war, und schien dadurch bald am meisten aufgeheitert. Auch das Kind, nachdem es seine erste Furcht überwunden hatte, schloss sich dem Jungen an und spielte so gern mit ihm, als wenn er ein Weißer gewesen wäre.
Er kannte schon anfangs einige englische Worte und lernte schnell, sich auszudrücken; obwohl er für einen Indianer ziemlich mitteilsam war, konnte ich aber doch von ihm nicht erfahren, wie oder von wem er verwundet worden war. Seine Stirn verfinsterte sich, sobald ich davon sprach, und er presste seine Lippen zusammen, als ob er lieber kämpfen als reden möge. Ich drang nicht weiter in ihn, überzeugt, dass früher oder später sich die Sache einmal aufklären werde.
Fortsetzung folgt: Kapitel 4 demnächst an dieser Stelle.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und auf diesem Weg geht es zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.